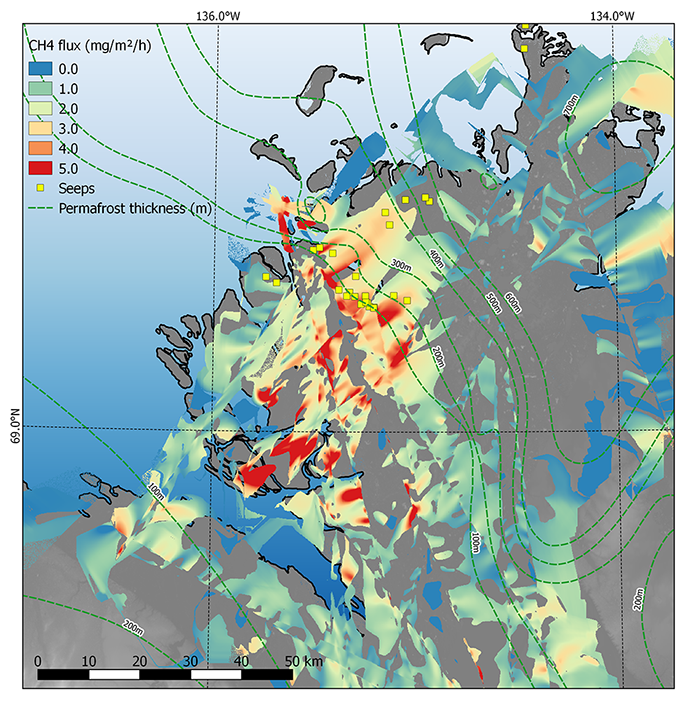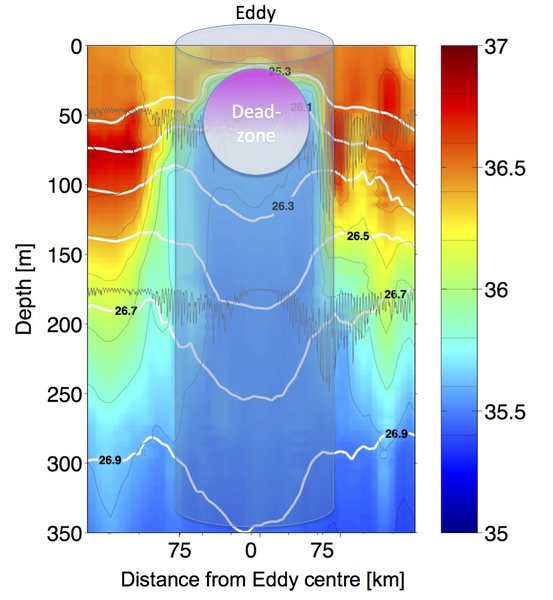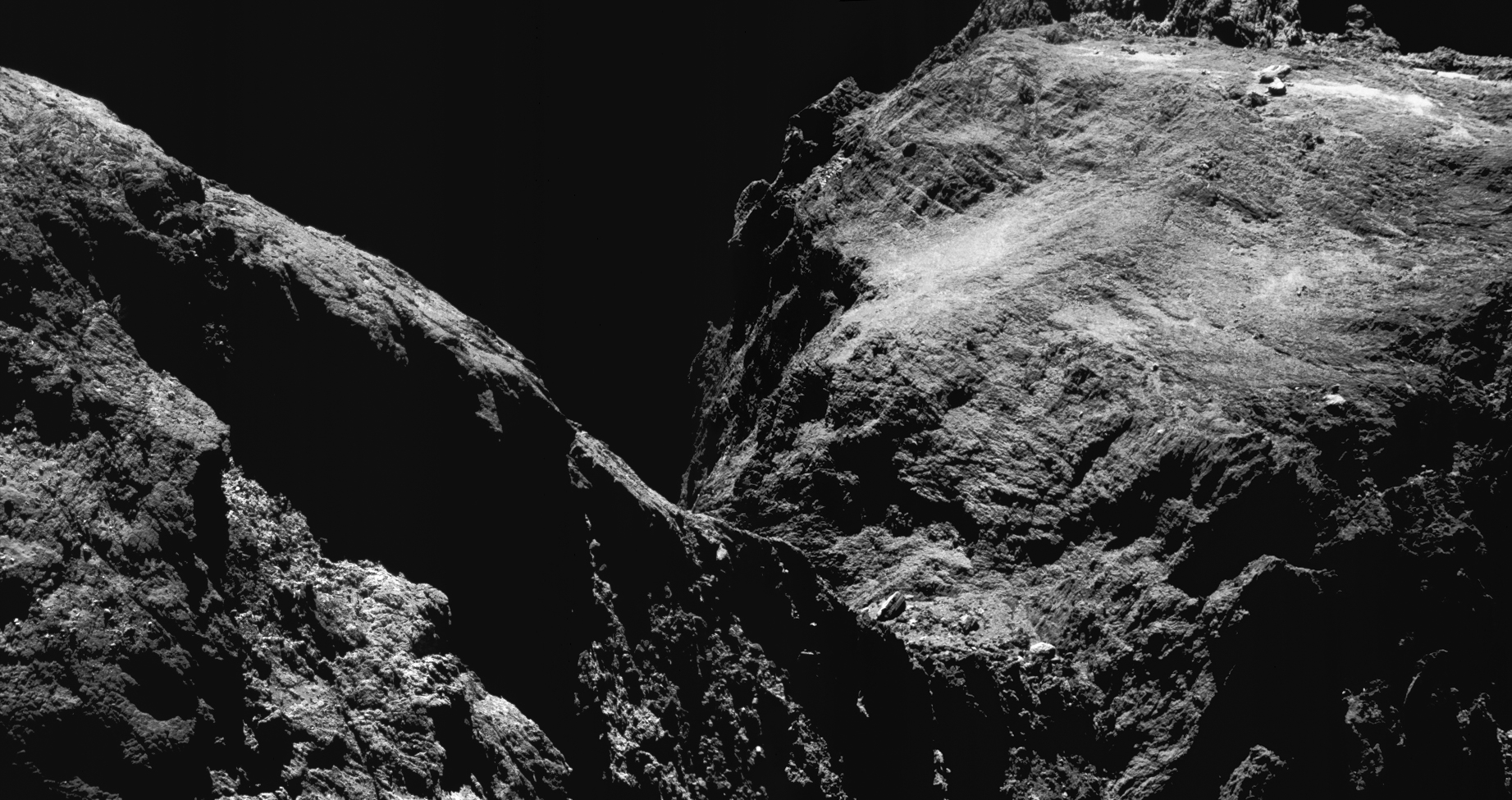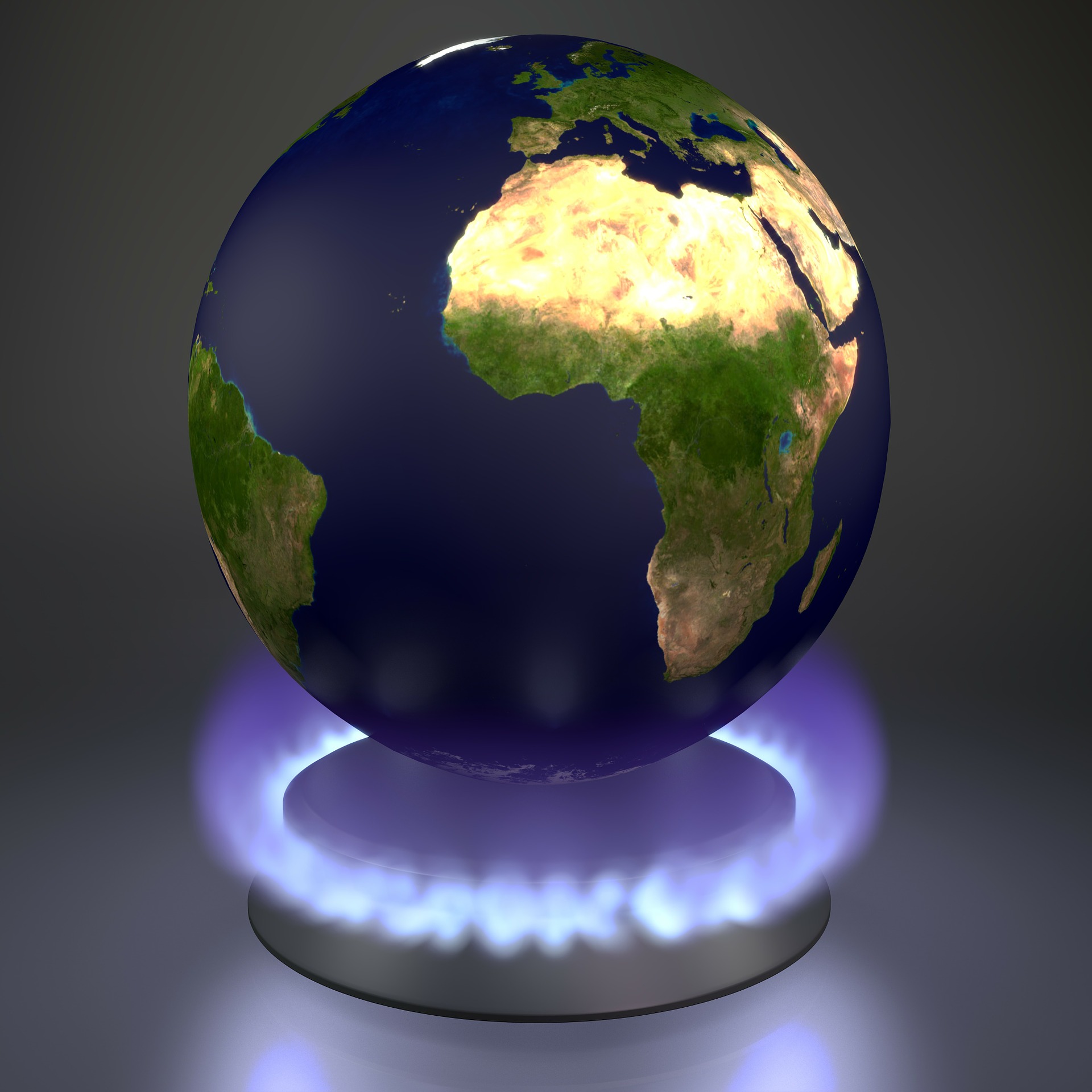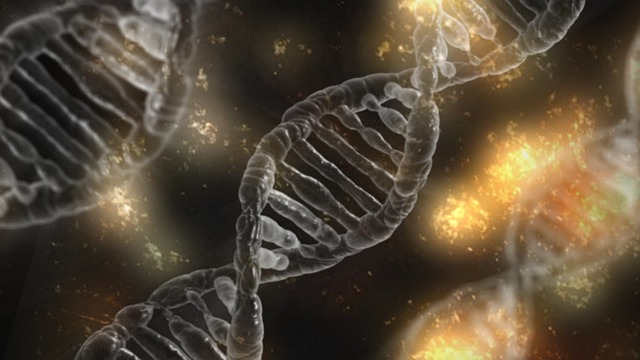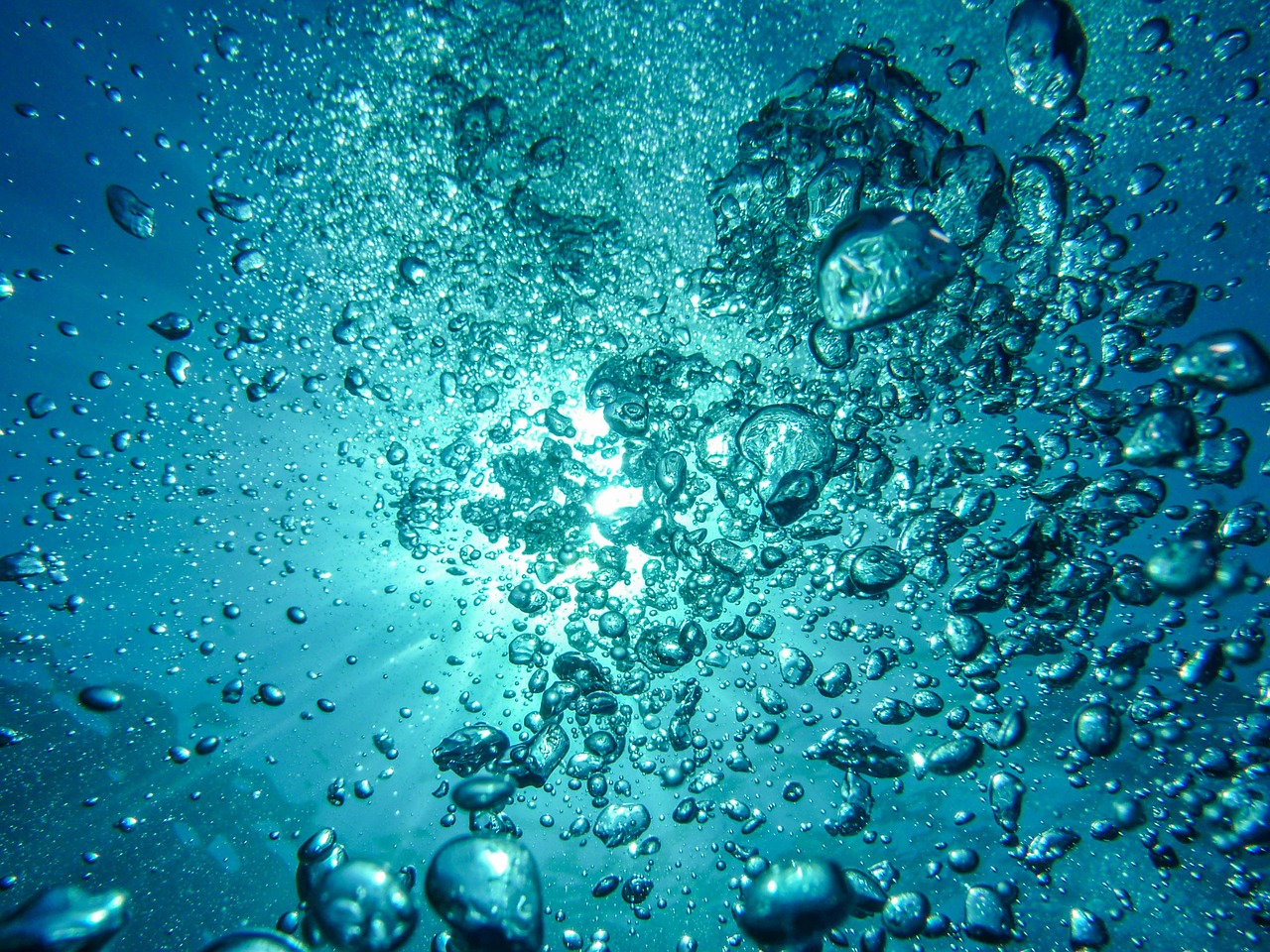Glimmermineral liefert den Schlüssel, wie Wasser Mineralien transportiert

Chemikern ist es gelungen, durch Analyse der Grenzfläche zwischen Muskovit und Wasser ein tieferes Verständnis für bestimmte Umweltprozesse zu gewinnen, was dabei behilflich sein kann, Schadstoffbelastungen besser in Angriff nehmen zu können.
Im speziellen widmeten sich die Forscher des Fachbereichs für Energie am Argonne National Laboratory in Kooperation mit der University of Illinois (Chicago) und der University of Delaware der Anhaftung und Freisetzung von Rubidium, einem Alkalimetall, das zwar nahe mit den Alkalimetallen Natrium und Kalium verwandt, aber weitaus besser zu isolieren ist.