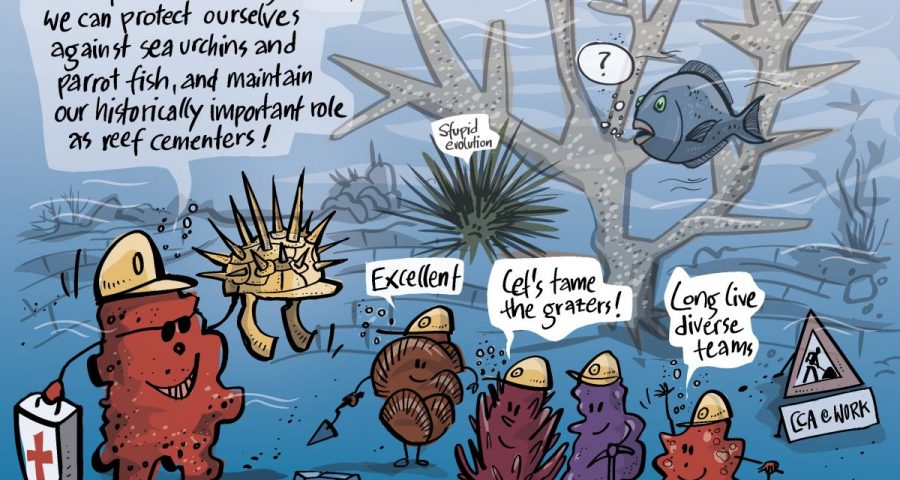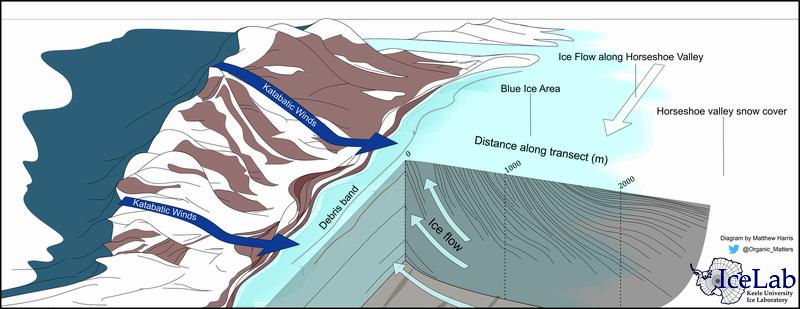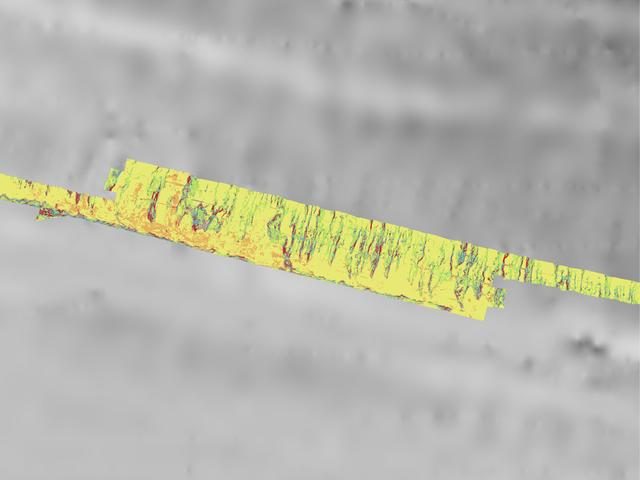Korallenriffe sind Hotspots der Biodiversität: Da sie auch schweren Stürmen standhalten, bieten sie vielen Tieren ein sicheres Zuhause. Gleichzeitig schützen sie dichtbesiedelte Küstenregionen, indem sie Sturmwellen abflachen. Doch wie können die aus oft fragilen Korallen aufgebauten Riffe so stabil sein? Ein Forscherteam der FAU und der Universität Bayreuth haben nun herausgefunden, dass ein ganz besonderer Zement dafür verantwortlich ist: Coralline Rotalgen bilden ein hartes Kalkskelett und stabilisieren die Riffe – und das seit mindestens 150 Millionen Jahren.
Weiterlesen