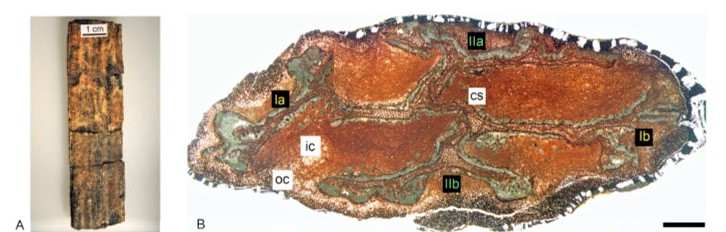Jeder, der eine lange Autofahrt oder Fahrradtour unternommen hat, hat ein Produkt aus der Familie der Spurgewächse – Gummi – verwendet. Die Spurgewächse oder Euphorbiaceae umfassen wirtschaftlich wertvolle Pflanzen wie den Kautschukbaum, den Rizinusölbaum, den Weihnachtsstern und die Maniokpflanze. Neu identifizierte Fossilien aus Argentinien legen nahe, dass vor vielen Millionen Jahren eine Gruppe von Spurgewächsen ihre eigene Reise unternommen hat.
Weiterlesen