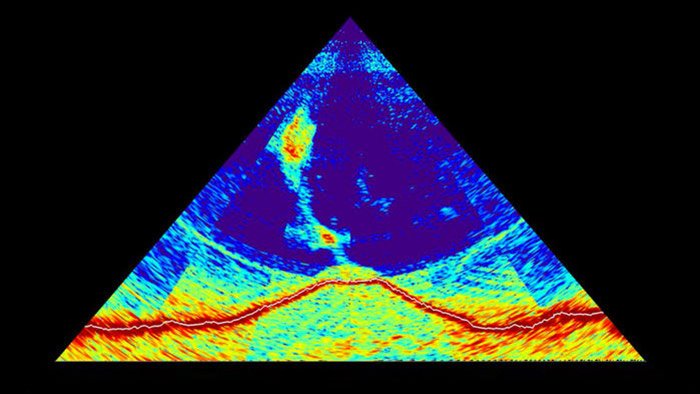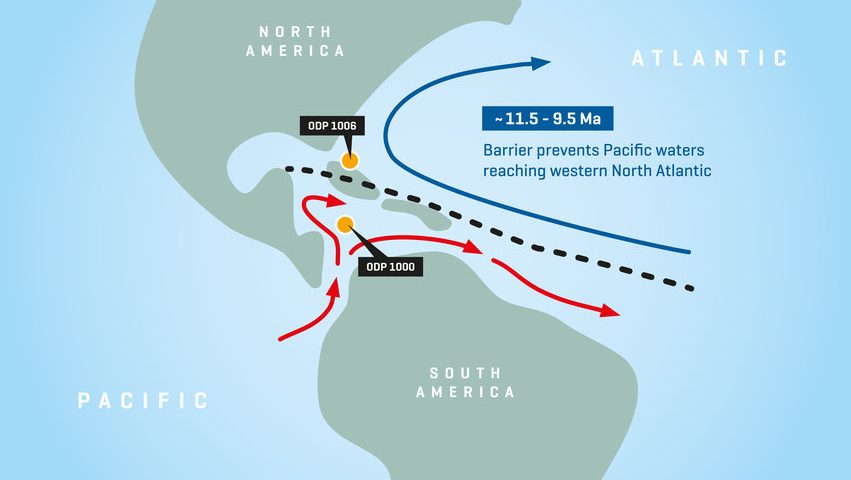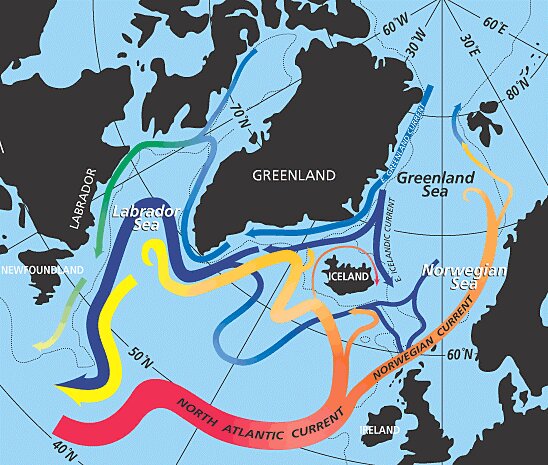Wenn ein heißer Magmaplume durch den Erdmantel aufsteigt und die darüber liegende Kruste durchstößt, kann sie nicht nur eine vulkanische Insel im Ozean schaffen, sondern auch eine hunderte bis tausende von Kilometern lange Welle in der Kruste. Im Laufe der Zeit wird die Insel von der darunter liegenden tektonischen Platte fortgetragen und der Plume bildet an ihrer Stelle eine weitere Insel. Über Millionen von Jahren kann dieser geologische Hotspot eine Kette von hintereinander liegenden Inseln hervorbringen, auf denen das Leben vorübergehend gedeiht, bevor die Inseln, eine nach der anderen, wieder im Meer versinken. Jetzt haben Wissenschaftler am MIT (Massachusetts Institute of Technology) eine Theorie über die Prozesse, die das Alter einer vulkanischen Insel bestimmen. In einer in der Science Advances veröffentlichten Arbeit berichten sie von einer Analyse von 14 großen vulkanischen Inselketten auf der ganzen Welt. Sie fanden heraus, dass das Alter einer Insel mit zwei geologischen Hauptfaktoren zusammenhängt: der Geschwindigkeit der darunter liegenden Platte und der Größe der durch den Hotspot-Plume erzeugten Schwellung.
Weiterlesen