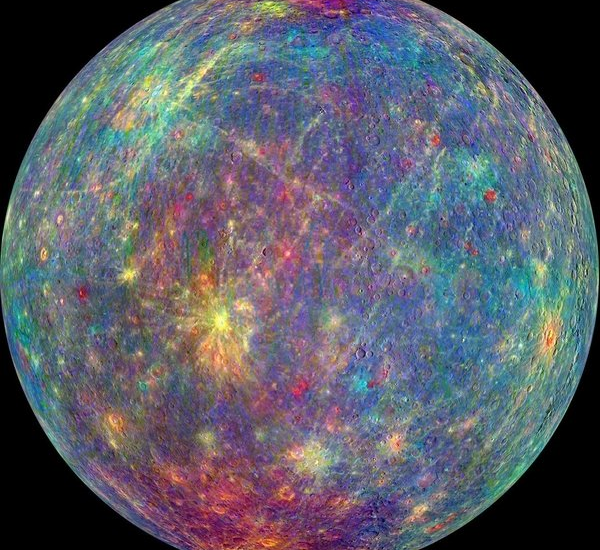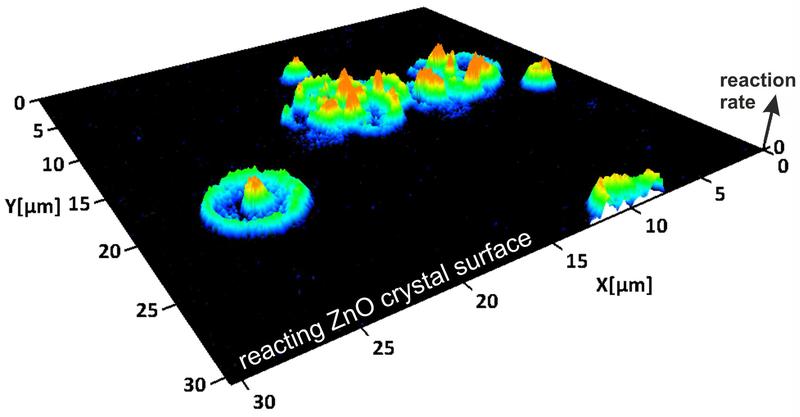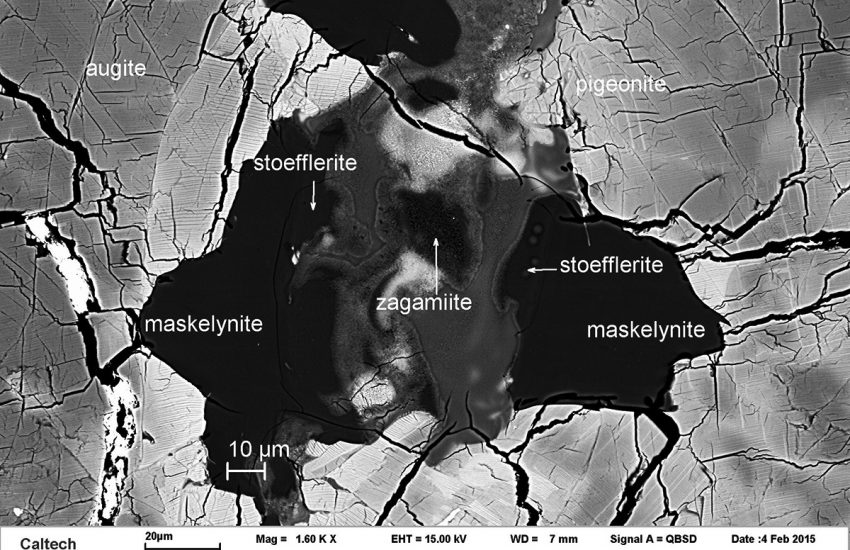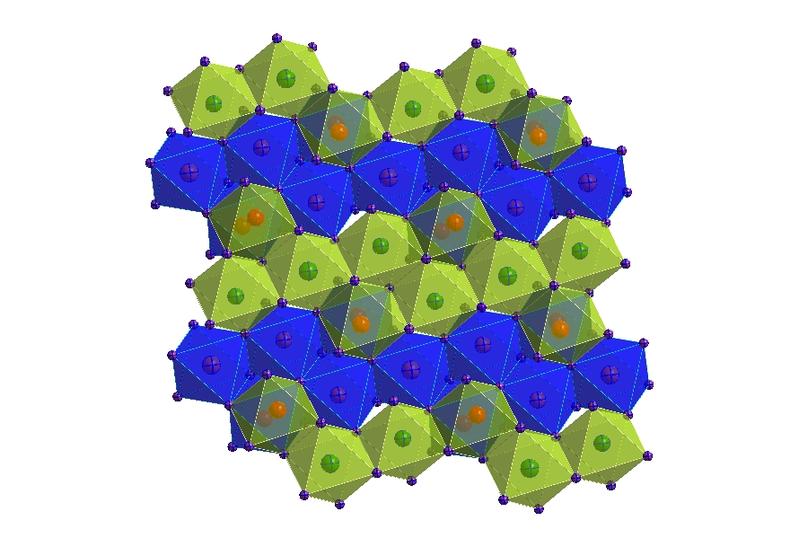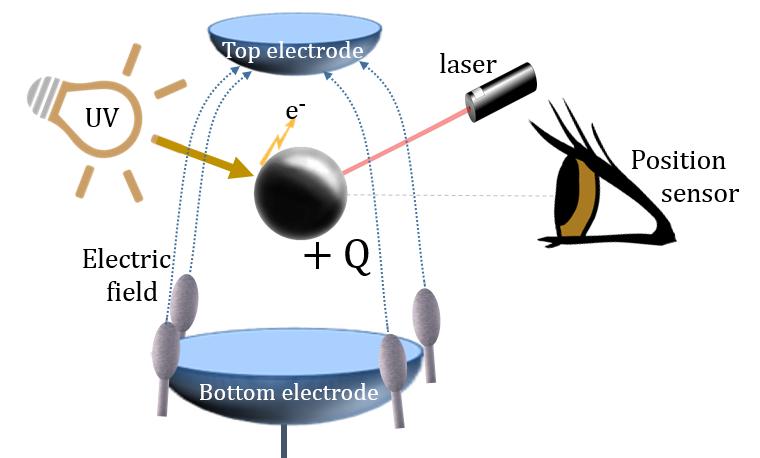Winzige Gipsnadeln können Algen so schwer machen, dass diese im Eiltempo absinken und auf diesem Weg große Mengen an Kohlenstoff in die Tiefsee transportieren. Dieses Phänomen haben Experten des Alfred-Wegener-Instituts erstmals in der Arktis beobachtet. Durch diesen massiven Algen-Abtransport könnten künftig dem Oberflächenwasser auch große Mengen an Nährstoffen verloren gehen.
Weiterlesen