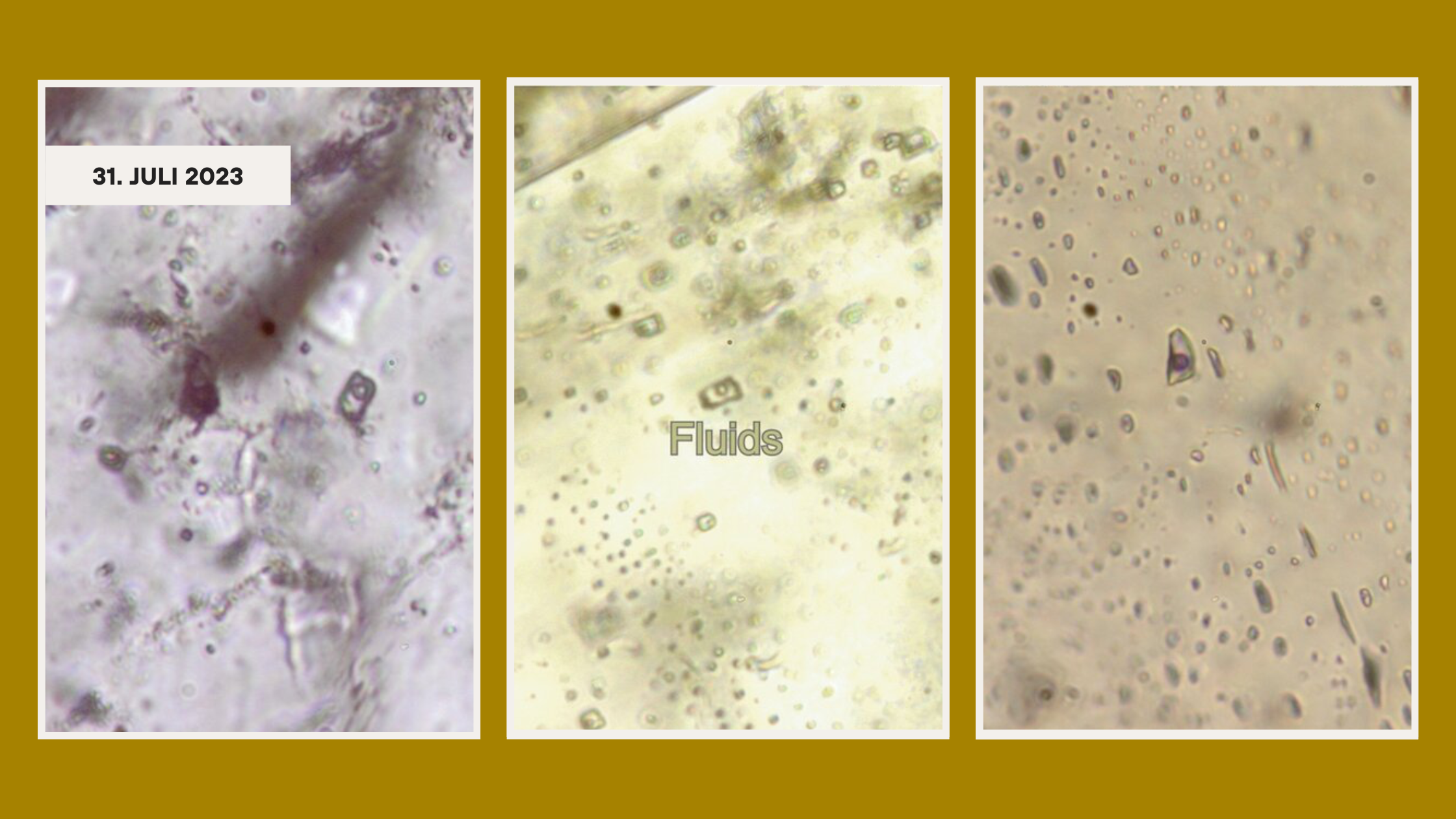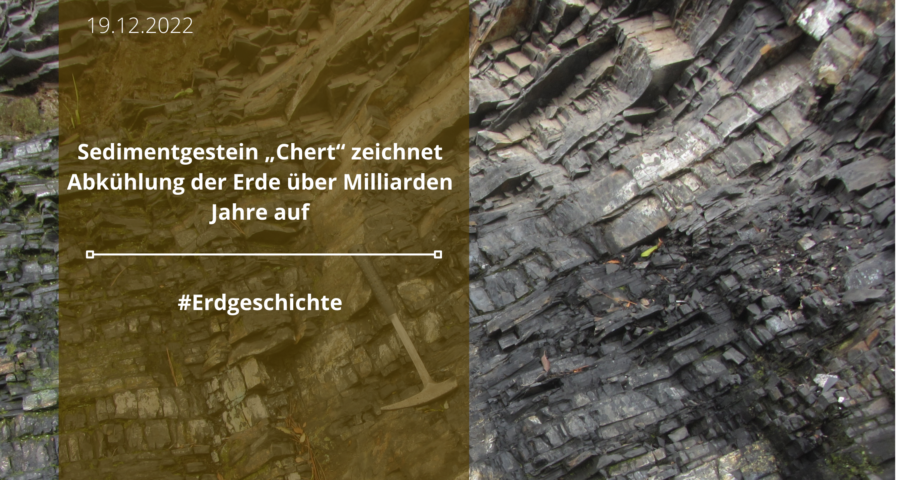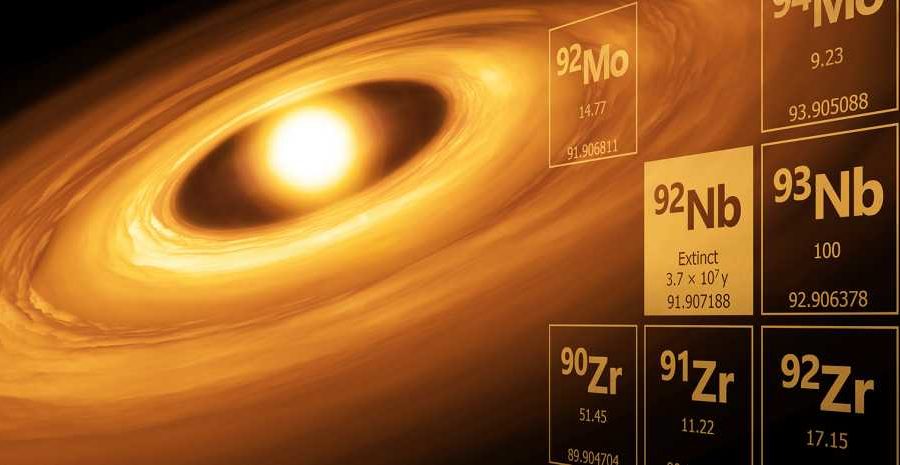Die Temperaturen in Ostafrika haben maßgeblichen Einfluss auf den globalen Klimakreislauf. Sie bestimmen den Wärme- und Feuchtigkeitstransport in die nördliche und südliche Erdhalbkugel und steuern damit auch das Klima in Europa. Wie genau sich in der Vergangenheit die Temperaturen in Ostafrika entwickelt haben, ist Gegenstand einer internationalen Studie unter Federführung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen ist. Dem Forscherteam um Dr. Thorsten Bauersachs ist es erstmalig gelungen, einen organischen Temperatur-Indikator, einen so genannten Proxy, zu entwickeln, mit dem sich die Klimageschichte des tropischen Ostafrikas anhand von Sedimentablagerungen des Tanganyikasees über die vergangenen 40.000 Jahre rekonstruieren ließ. Mit Hilfe dieses neuen Proxys (HDI26) konnte das Team einen Temperaturanstieg von rund 4° C in den vergangenen 18.000 Jahren nachweisen, davon allein etwa 1° C in den letzten 250 Jahren.
Weiterlesen