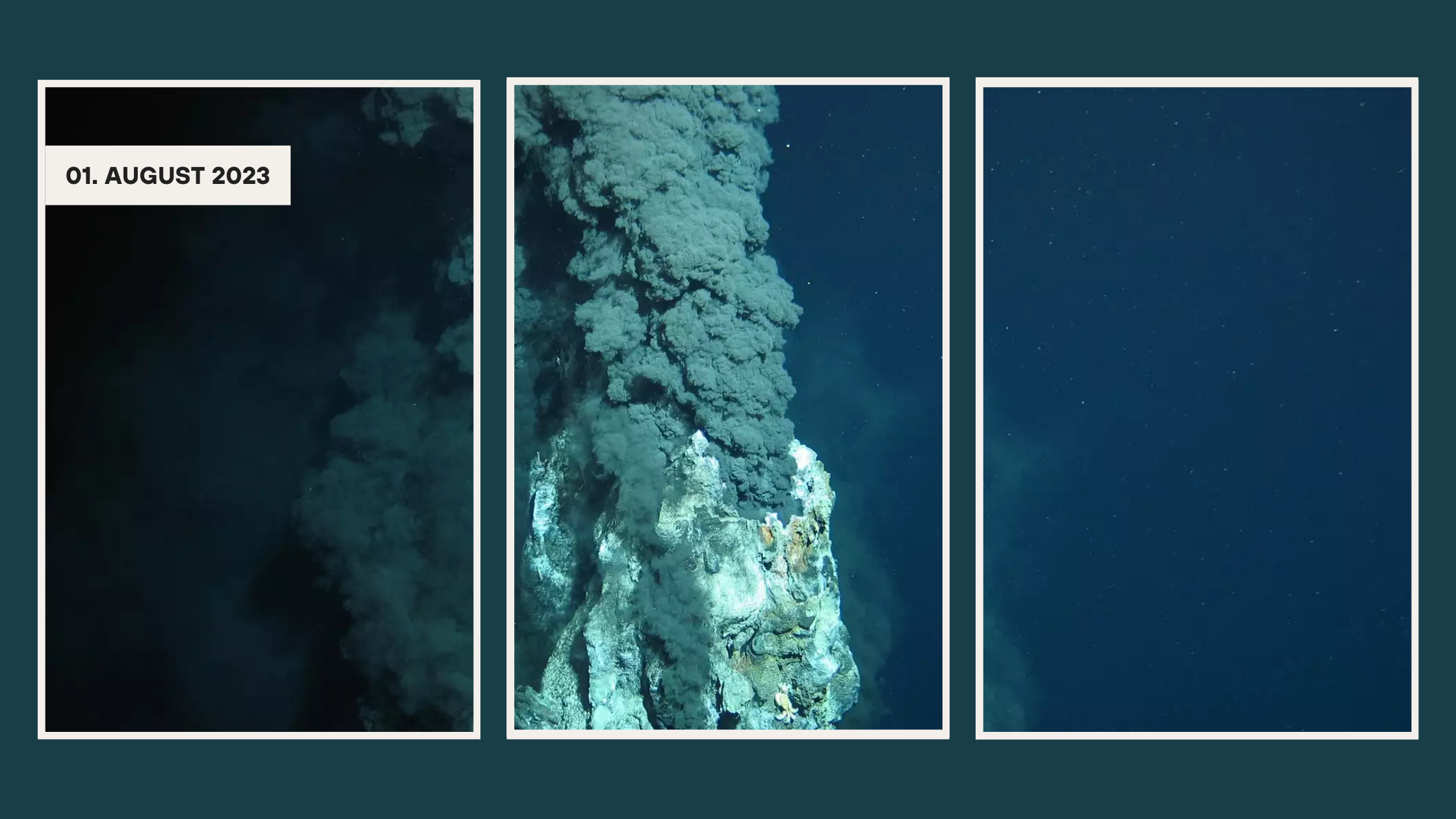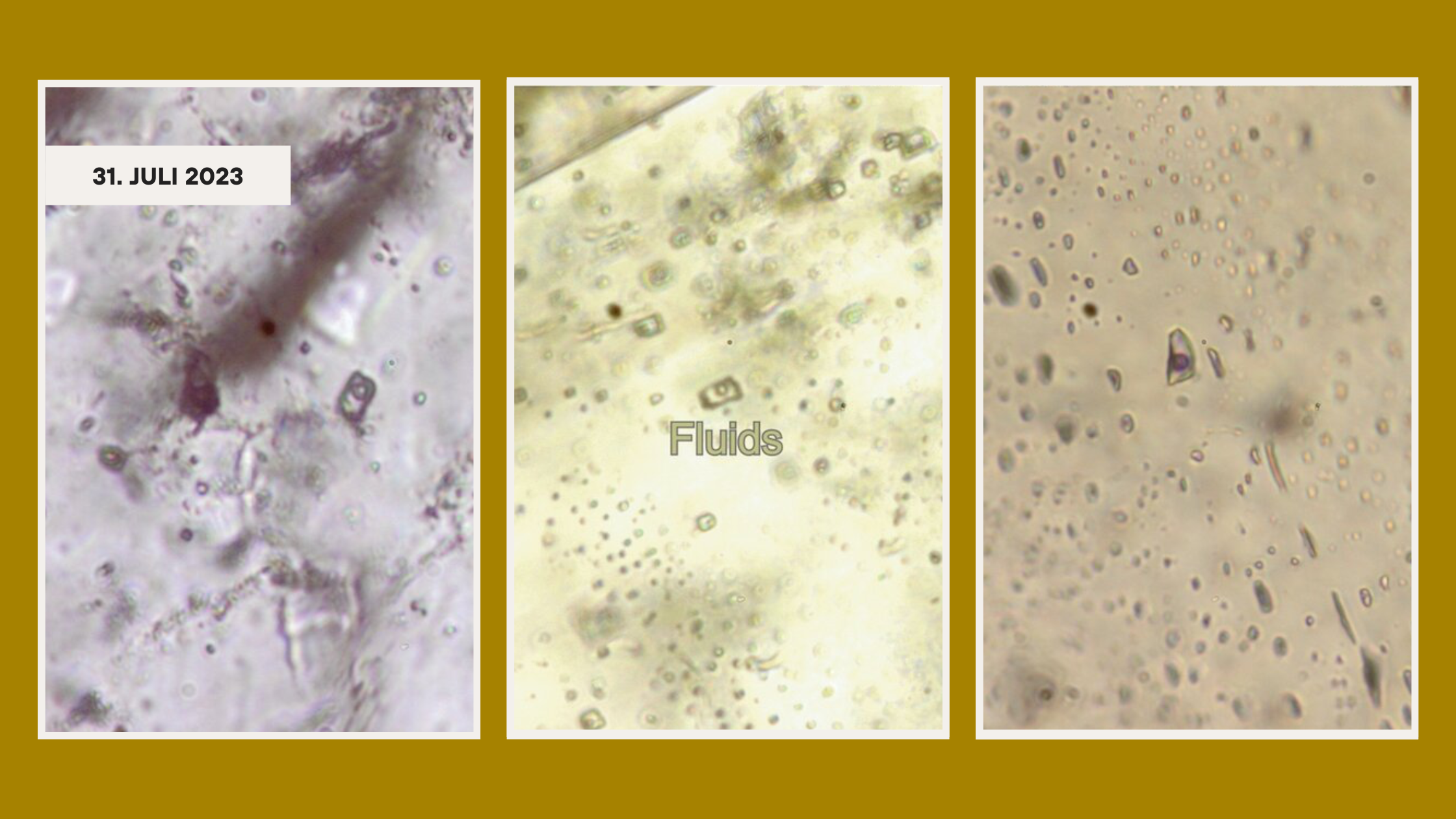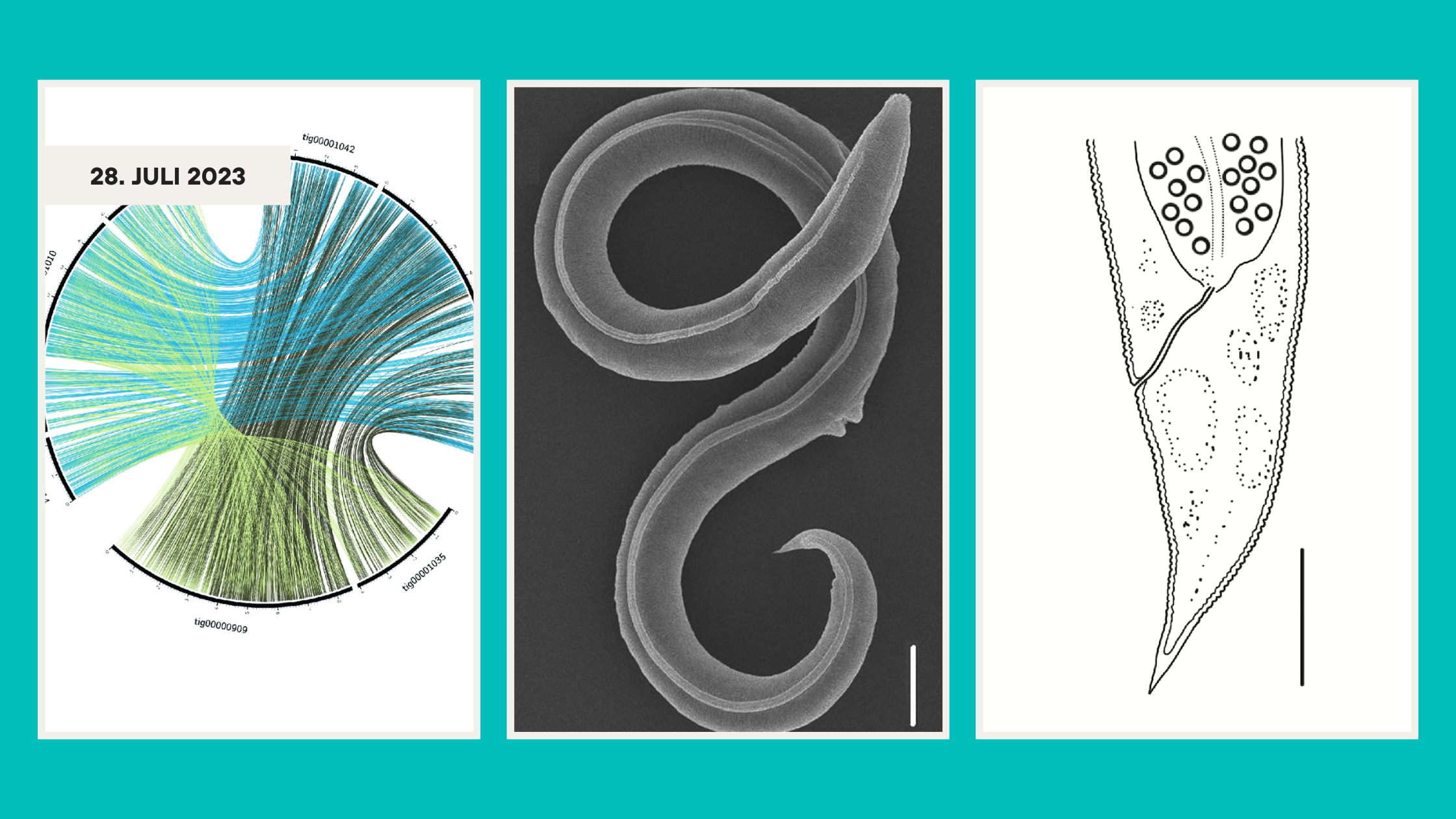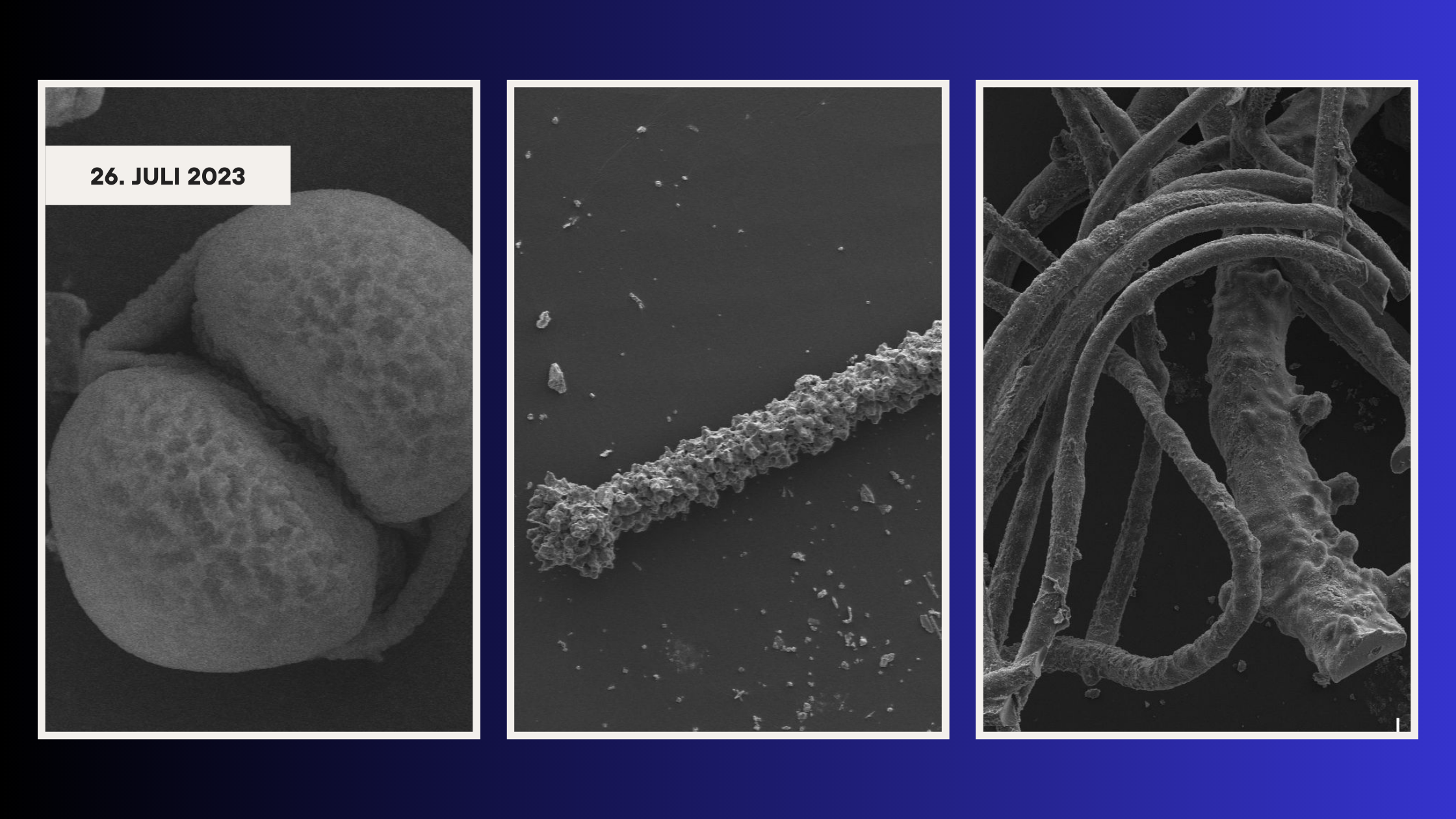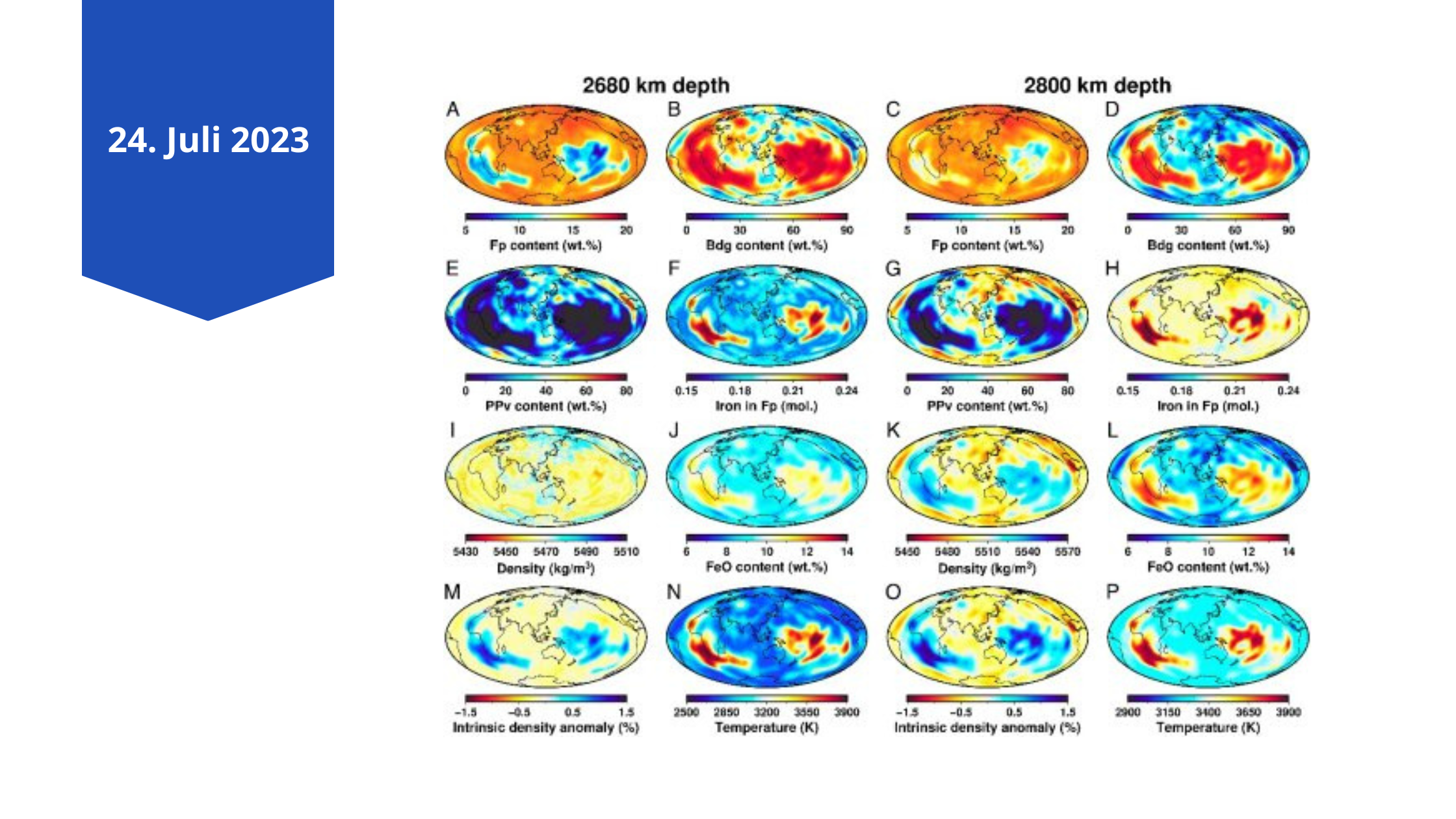Forschende des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt haben entschlüsselt, welche Faktoren die enorme Vielfalt von pflanzenfressenden Insekten bestimmen. In ihrer heute im Fachjournal „PNAS“ erschienen Studie zeigen sie, dass sich die Diversität der herbivoren Insekten in den letzten 60 Millionen Jahren hauptsächlich durch die gemeinsame Nutzung von Nahrungspflanzen entwickelte. Hierfür analysierte das Forschungsteam die Fraßspuren von Gliedertieren an mehr als 45.000 fossilen Blättern.
Weiterlesen